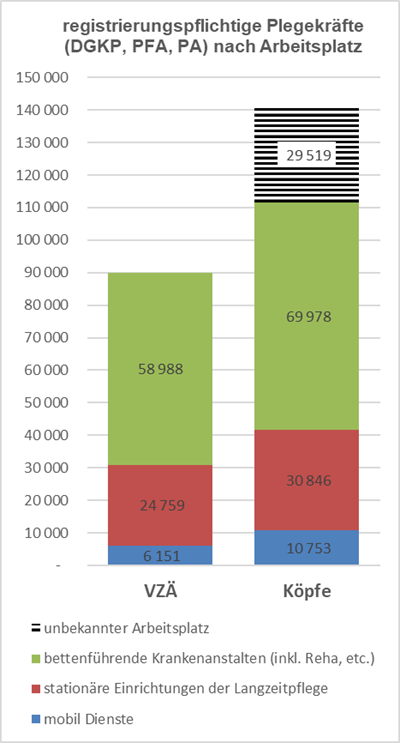Wir erleben eine Ausnahmesituation, keinen Normalbetrieb.
Weiterlesen: Wir sind bestens gerüstet für Covid-19Stand 25. März, 13 Uhr: Es schaut wirklich gut aus. Die Krankheitsverläufe sind leichter als in anderen Ländern, Spitäler und Intensivabteilungen (noch) „leer“. Aber weil es bei uns aktuell so richtig gut geht, hören wir immer öfter, dass das was mit unserem Gesundheitssystem zu tun hat! Und ja, das stimmt.
Was wir erleben, ist eine Pandemie einer Infektionskrankheit, die akut verläuft. Für die meisten wird es nicht mehr sein, als sich ein paar Tage „grippig“ zu fühlen, wenn überhaupt (wir wissen nicht, wie oft eine stille Feiung vorkommt). Aber bei relativ wenigen wird das Virus die Lunge derart belasten, dass sie richtig krank sind und zum Arzt müssen. Viele werden in Spitäler kommen und einige davon, vor allem Alte und chronisch Kranke, auch intensiv versorgt werden müssen.
Das Problem ist, dass relativ wenige absolut sehr viele sein werden. Möglicherweise werden die Spitalsaufnahmen in den nächsten Wochen doppelt oder dreifach so hoch ausfallen wie normalerweise. Doch das wird unser System stemmen!
Denn unser Gesundheitssystem – und das unterscheidet es von praktisch allen auf der Welt – ist für den Fall einer Pandemie einer akut verlaufenden Infektionskrankheit bestens ausgerichtet.
Wir haben die höchste Facharztdichte der Welt und daher auch die höchste Zahl an Facharzt-Patienten-Kontakten. Wir haben die meisten Spitalsbetten, die meisten Intensivbetten, die meisten Krankenhausaufnahmen und auch die meisten Rettungshubschrauber. Unser Gesundheitssystem organisiert routiniert alles rund um akute Krankheiten, in struktureller Qualität und Quantität wie sonst nirgends. Wir haben praktisch ein reines Akut-Versorgungssystem, das genau in Fällen wie diesem nicht zu überbieten ist.
Und weil wir verglichen mit praktisch allen Ländern der Welt aus der Routine heraus schon immer für eine Pandemie „vorbereitet“ waren, auch wenn wir zwischenzeitlich die dafür nötigen Überkapzitäten eben mit unnötigen Behandlungen ausgelastet haben, verführt das jetzt so manchen, das „Österreichische System“ zu loben und zu preisen.
Doch das ist falsch – denn das, was wir jetzt erleben, ist eine Ausnahmesituation, kein Normalbetrieb. In ein paar Wochen, wenn wieder alles normal ist, wird der typische Patient nicht mehr an einer akuten Krankheit leiden. Er wird wieder Diabetiker sein oder COPD, Herzinsuffizienz oder Bluthochdruck haben oder wegen seines Alters eben multimorbid sein. Und für genau diese Patienten, die keine akute Behandlung, sondern eine lebenslange Versorgung brauchen, haben wir eben kein System. Deswegen haben wir bei Diabetikern die höchste Amputationsrate oder bei COPD-Patienten die höchste Hospitalisierungsrate – weil wir bei allen Patienten eben erst reagieren, wenn sie ein akutes Problem haben, das sie aber nicht haben müssten, wenn unser System sich an chronischen und nicht akuten Krankheiten orientierte. Chronisch Kranken geht es in unserem System echt schlecht. Aber ich weiß jetzt schon, dass jegliche Neustrukturierung des „Österreichischen Systems“, um chronisch Kranke besser zu versorgen, in den nächsten Jahren mit dem Argument abgeschmettert werden wird, es habe sich doch bestens bewährt – in der Corona-Krise.
„Wiener Zeitung“ vom 26.03.2020