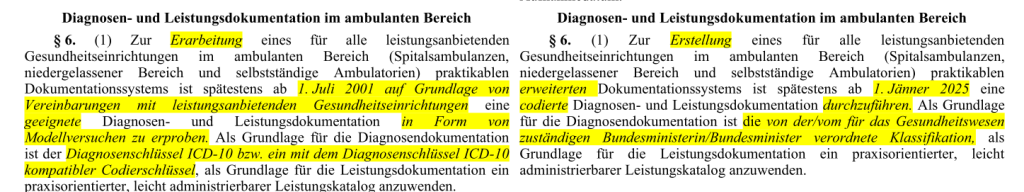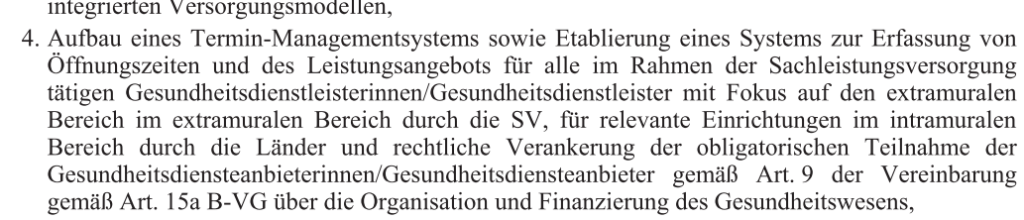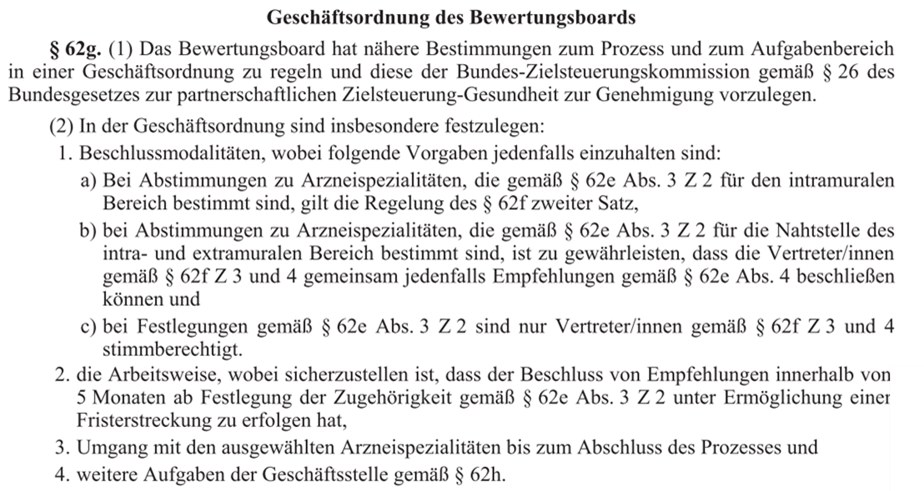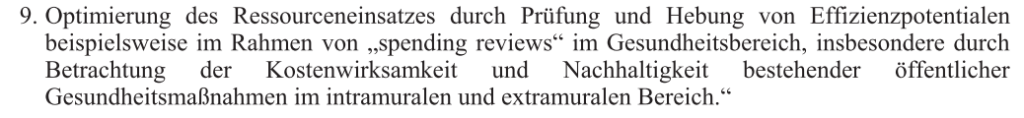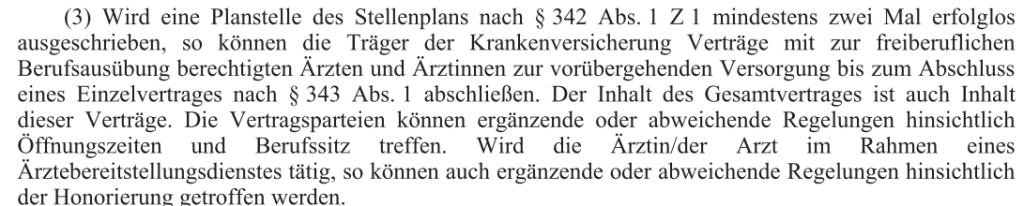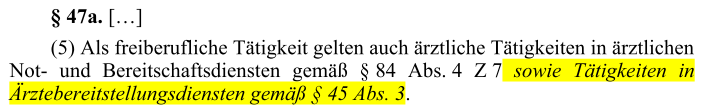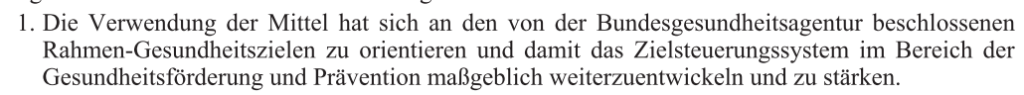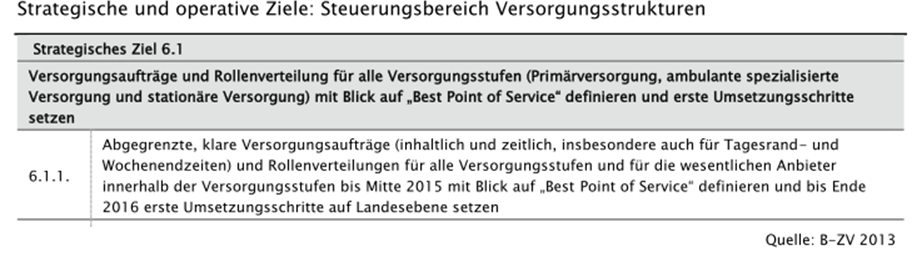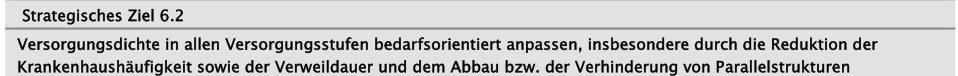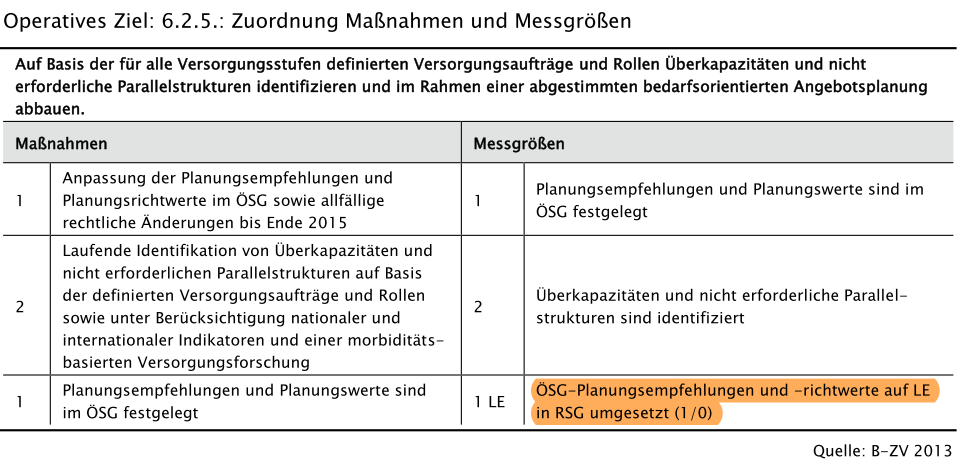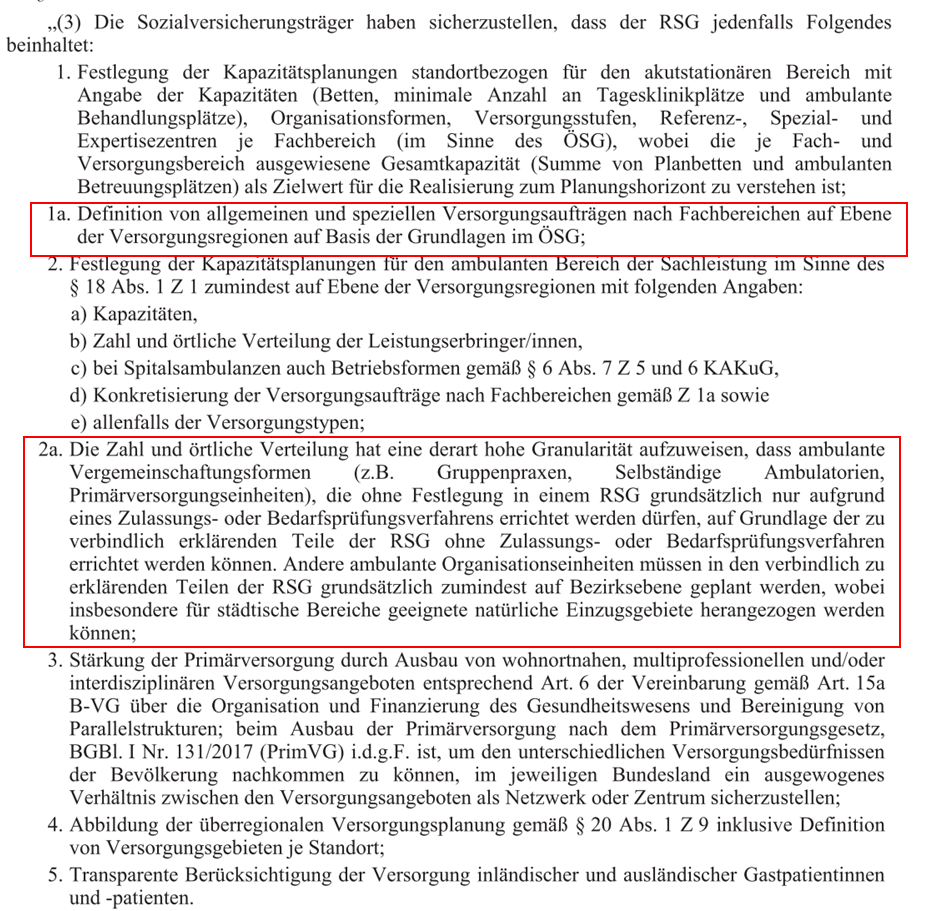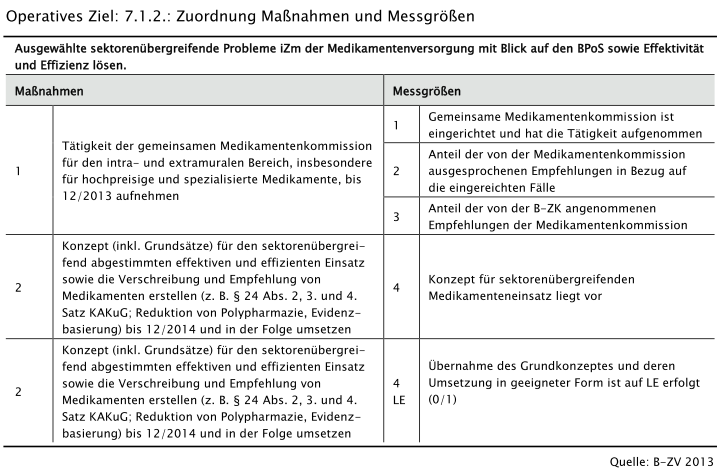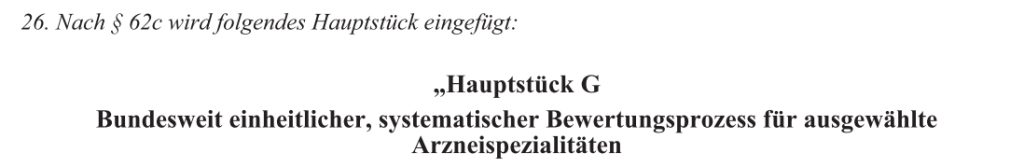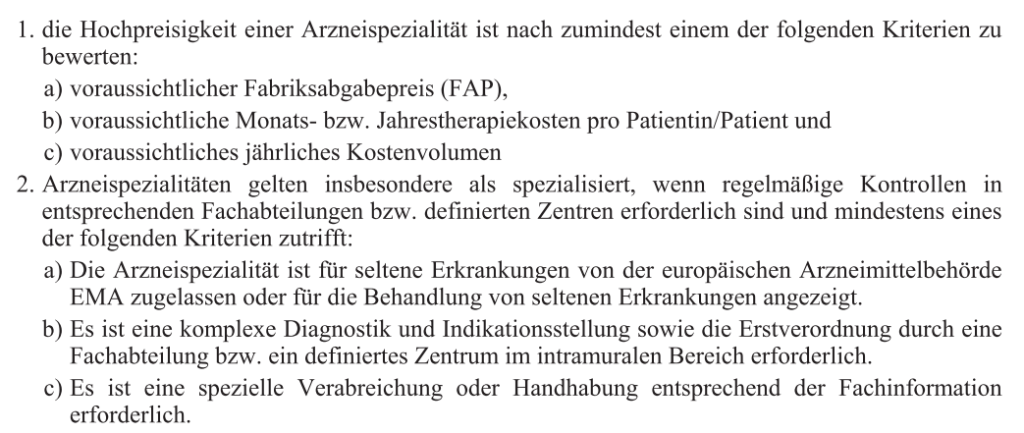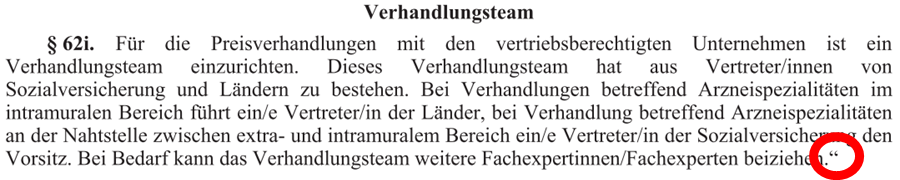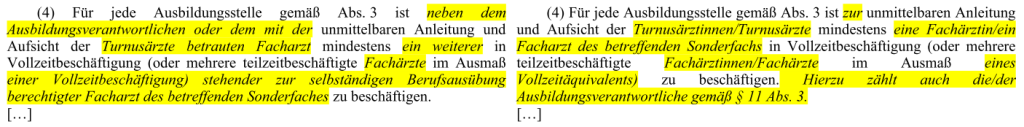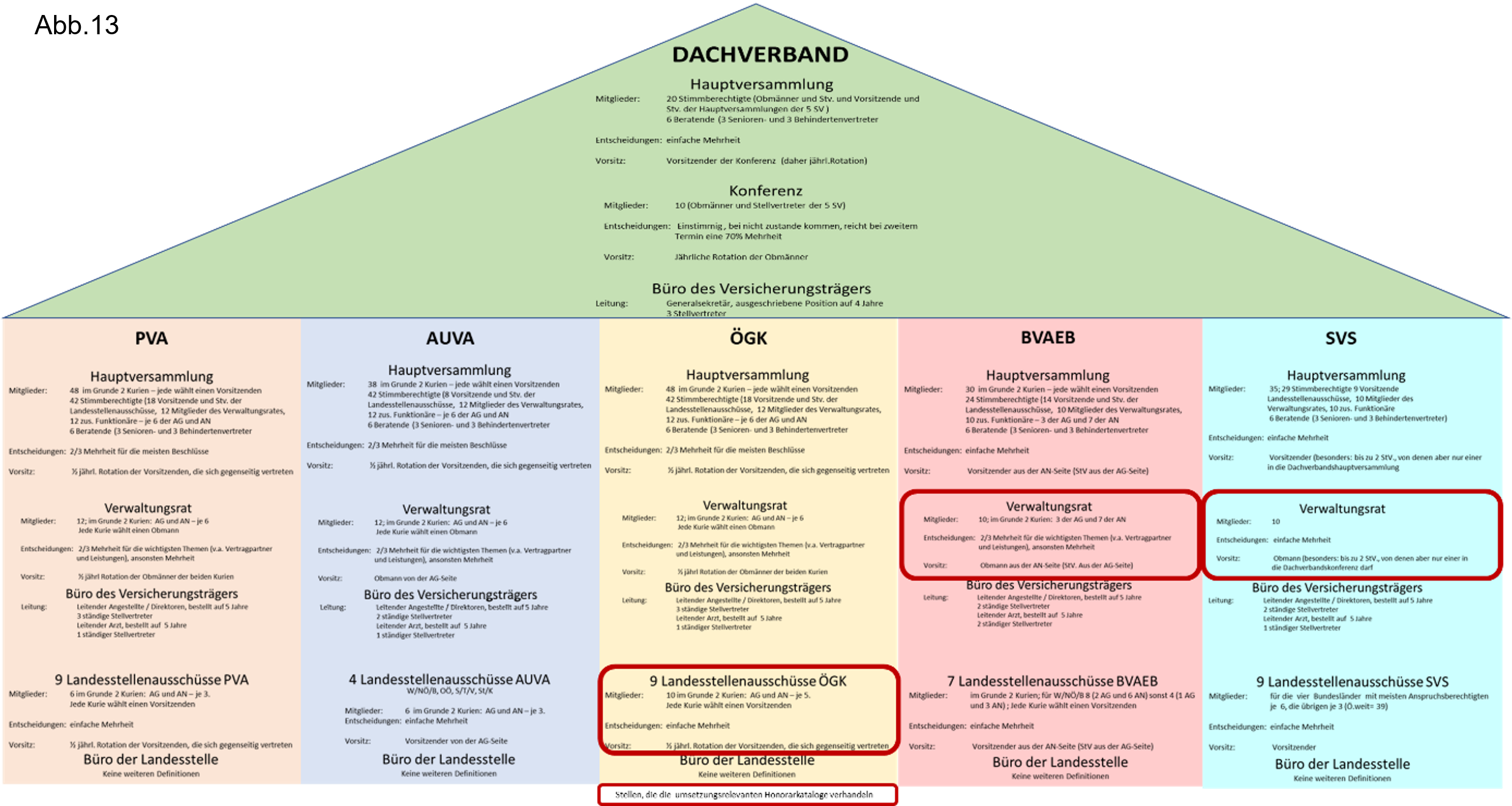Das weltbeste Gesundheitssystem ist ein geliebter und heiß verteidigter Mythos
(Vor fast 20 Jahren habe ich das geschrieben und bringe es ohne Aktualisierung wieder an die Öffentlichkeit, auch wenn die eine oder andere Zahl sich verändert haben könnte – es ist einfach Irrsinn)
Lesezeit 6 Min
In Österreich wird seitens der Politik gerne davon gesprochen, das weltbeste Gesundheitssystem zu haben. Vor gar nicht langer Zeit hatten wir noch das sechstbeste. Und ohne spürbare Maßnahmen wurde es beinah über Nacht (eigentlich über einen Regierungs- und Ministerwechsel) das „beste“. Das Sprechen in solchen Superlativen gehört mittlerweile zur Routine der Politik. Da ist jedoch nicht ungefährlich, im Gesundheitswesen sogar fahrlässig.
Weiterlesen: Österreich – das weltbeste Gesundheitssystem?! (ein Blick ins Jahr 2006, als dieser Artikel erschien!)Was bedeutet der Superlativ „das weltbeste“ für das Gesundheitswesen? Für viele politische Entscheidungsträger in den Ländern, Kammern und den Sozialversicherungen bedeutet es, dass es keinen echten Reformbedarf gibt, ja nicht einmal Handlungsbedarf; nur mehr Geld, wenn es denn nötig ist, um „das weltbeste“ System aufrechtzuerhalten. Für die Leistungserbringer im weltbesten Gesundheitssystem, also vornehmlich Ärzte, kann es nichts anderes bedeuten, als dass ihre Qualität auf höchstem, allerhöchstem Niveau ist, ihre Leistungen nicht übertreffbare Resultate erzielen und daher – auch wenn wenige einzelne vielleicht wenige vernachlässigbare Fehler machen – keine wesentlichen Verbesserungen möglich sind. Es besteht also ein Milieu, in dem es keine Fehler gibt und keine Fehler zugegeben werden brauchen. Für die Patienten bedeutet es, dass das, was sie in Österreich erhalten, nirgendwo in der Welt besser erbracht werden kann, und das noch dazu „gratis“ („There is free lunch in Austria?!“). Egal wo auf dieser Welt man hinginge, es würde nicht besser sein, aber ganz sicher teurer. In diesem Glauben werden Patienten zu unkritischen Konsumenten. Und die Informationsasymmetrie zwischen Arzt und Patient, die so oft als Begründung für das Beibehalten des Pflichtversicherungssystems angeführt wird und als Basis der sogenannten Selbstverwaltung dient, wird immer größer statt kleiner. Und alle zusammen wiegen sich in der trügerischen „fehlerlosen“ Sicherheit des angeblich besten Systems der Welt.
In den letzten Wochen wurde bekannt, dass wieder ein Kind an den Komplikationen einer Mandeloperation starb, und wenn man den Medien glauben schenken will, dann war es innerhalb eines Jahres das sechste Kind – das ist sehr viel. Wenn man bedenkt, dass es in diesem Zeitraum in etwa 9.000 Mandeloperationen gab, dann bedeutet das, dass die Sterblichkeit an Komplikationen wenigstens in diesem Jahr bei eins zu 1.500 lag. In der Literatur findet man eine Sterblichkeitsrate von 1/16.000 bis 1/35.000 (Clin Otolaryngol 2000; 25 : 110-7). In Italien, das, wenn Österreich wirklich das beste Gesundheitssystem der Welt hat, ein schlechteres haben muss, stirbt gar nur ein Patient pro 95.000 Operationen (Pediatr Med Chir. 2004 May-Jun;26(3):179-86). Im besten System der Welt sollte man daher höchstens einen Todesfall in vier bis zehn Jahren zu beklagen haben; sechs Tote in einem Jahr sind nicht einmal dann zu erklären, wenn das letzte Jahr ein statistischer Ausreißer wäre.
Die wichtigste Komplikation und damit auch Todesursache Nummer eins bei Mandeloperationen ist die Nachblutung. Sie tritt bei 3% bis 4% aller Patienten auf. An den Nachblutungen entbrennt aktuell auch die Diskussion, ob man die Kinder länger im Spital lassen sollte, um die Sterblichkeit zu reduzieren. Eine eigenartige Maßnahme, denn mehr als 80% aller Nachblutungen treten innerhalb der ersten 4 Stunden nach der Operation auf. Ein Vergleich der Behandlungsergebnisse und Komplikationsraten in anderen Gesundheitssystemen zeigt, dass sowohl die tagesklinische als auch die stationäre Behandlung die gleichen Resultate erbringt. (Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Volume 68, Issue 11, Pages 1367-1373 (November 2004)). Wenn man aber an das Kind denkt und die psychische Belastung, die jede stationäre Behandlung nach sich zieht, dann ist die Entscheidung für die tagesklinische Behandlung eigentlich logisch – wenigstens in anderen Gesundheitssystemen ist das so.
Wenn man gefährliche Nachblutungen vermeiden will, dann sollte man andere Maßnahmen setzen, als den stationären Aufenthalt zu verlängern. In Italien, das mit einem Todesfall pro 95.000 Operationen wahrscheinlich die beste Versorgung für seine Bevölkerung bereitstellt, werden beispielsweise nur 11 Operationen pro 10.000 Einwohner durchgeführt. In Österreich sind es 67. Kann es sein, dass die Österreicher wirklich fast 7mal öfter operiert werden müssen; oder wird in Österreich zu schnell zum Messer gegriffen? Als Argument für den schnellen Griff zum Messer wird gerne angeführt, dass eine geplante Operation viel weniger Komplikationen hat, als wenn man in eine vereiterte Mandel hineinoperieren muss. Das stimmt leider nicht (Acta Otolaryngol. 2005 Dec;125(12):1312-7). Genauso in das Reich der Märchen ist die Aussage zu verbannen, dass mit der Mandeloperation häufige Halsentzündungen oder Mittelohrentzündungen vermieden werden können (Laryngoscope. 115(4):731-734, April 2005; Arch Dis Child.2005; 90: 19-25). Genaugenommen, gibt es bei einer so hohen Sterblichkeitsrate, wie sie in Österreich beobachtet wird, gar keine Begründung für eine Mandeloperation. Will man also Nachblutungen wirklich verhindern, dann müssen die Operationen auf das medizinisch notwendige Maß reduziert werden, nicht die stationären Aufenthalte verlängert!
Aber auch eine zusätzliche Maßnahme könnte helfen, die Sterblichkeit zu reduzieren. Dafür ist jedoch ein realpolitisches Unwort zu verwenden: Zentralisierung. Es ist in anderen Gesundheitssystemen nachgewiesen worden, dass es eine Erfahrungswertkurve für die Mandeloperation gibt. Und noch mehr. Die Nachblutungsrate bei Patienten, die durch einen geübten Krankenhausarzt behandelt wurden, ist halb so hoch, wie die bei Konsiliarärzten oder Assistenzärzten (Acta Otolaryngol. 2005 Dec;125(12):1312-7). In Österreich werden Mandeloperationen in so gut wie jedem Spital angeboten, unabhängig ob es dort eine HNO-Abteilung gibt oder nicht. In der Regel sind es Konsiliarärzte die in den „kleinen“ Spitälern die Operation durchführen. Das Spital und in der Regel auch die Politik betrachtet das als sogenannte wohnortnahe Behandlung. Sie ziehen so den zentralen HNO-Abteilungen die Fälle ab. Doch selbst wenn die Fälle in HNO-Abteilungen behandelt würden, gehört die Mandeloperation bei HNO-Spitalsärzten nicht gerade zu den beliebtesten und wird erfahrungsgemäß gerne von den Oberärzten an die Assistenzärzte abgetreten.
Aber weder eine OP-Reduktion noch eine Zentralisierung sind Maßnahmen, die in unserem Gesundheitssystem diskutiert werden. Müssen Sie ja auch nicht, weil man ja davon ausgehen kann, dass die österreichischen Daten, die des besten Gesundheitssystems der Welt sind und einem Vergleich mit anderen nicht bedürfen.
Leider ist zu sagen, dass es nicht nur die Mandeloperationen sind, an denen man, wenn man genauer schaute, manches feststellen könnte. Ein anderes Beispiel ist etwa die Blinddarmoperation. Es gilt als gesichert, dass pro 100.000 Einwohnern etwa 85 Blinddarmentzündungen auftreten (Dig Surg 2001;18:61–66). Da man im Falle eines Verdachts auf Blinddarmentzündung bereits operieren sollte, ist es internationaler Standard, dass etwa 20% der entfernten Blinddärme keine Entzündung gehabt haben dürfen – nicht mehr. Die Diagnosemöglichkeiten sind heute soweit ausgereift, dass, legt man es darauf an, dieser Wert sogar auf 10% gesenkt werden kann (Radiology 2003;226:101-104). Damit würde man erwarten, dass in einem guten Gesundheitssystem nicht mehr als 95 – 100 Blinddarmoperationen pro 100.000 Einwohner durchgeführt werden. In Österreich, dem Land in dem sehr, sehr viele „kleine“ Krankenhäuser um ihre Rechtfertigung kämpfen, werden 175 Operationen pro 100.000 Einwohner durchgeführt. Vielleicht liegt es ja an einem unbekannten, österreichspezifischen epidemiologischen Problem, dass in Österreich so viele Operationen nötig werden. Ob dann jedoch die Operation die richtige Maßnahme wäre, um diesem Problem zu begegnen? Sollte es dieses unbekannte Problem allerdings nicht geben, liegt der Verdacht nahe, dass auch im Fall der Blinddarmoperationen das Messer zu schnell eingesetzt wird. Zwar liegen aus Österreich keine Daten über die Sterblichkeit im Rahmen einer Blinddarmoperation vor, aber aus anderen Gesundheitssystemen weiß man, dass bei einer von 400 Operationen etwas so drastisch schief geht, dass der Patient stirbt (Annals of Surgery. 233(4):455-460, April 2001). In Österreich werden etwa 14.000 Blinddarmoperationen pro Jahr unter dem Titel Blinddarmentzündung durchgeführt. Das sind verglichen mit anderen Gesundheitssystemen jährlich 6.000 Operationen mehr als erwartet. Und 6.000 durch 400 sind 15!
Ähnliches ließe sich auch für Herzkatheter-Untersuchung, eine Behandlung mit einer Sterblichkeit von einem Prozent, sagen, die in Österreich eineinhalb mal so oft durchgeführt wird, als die Krankheitshäufigkeit erwarten ließe – vielleicht deswegen, weil wir auch doppelt so viele Untersuchungsplätze haben als wir bräuchten? Oder die Komplikationsraten und die Krankenhausverweildauer bei endoskopischen Gallenblasenoperationen, die höher liegen als in allen anderen Gesundheitssystemen – vielleicht deswegen, weil es halt auch zu viele, zu kleine chirurgische Abteilungen gibt?
Kann es vielleicht doch sein, dass das „weltbeste“ Gesundheitssystem strukturelle Probleme hat? Und genau diese Frage ist es, die man in Österreich nicht stellt, ja nicht stellen darf, weil man ja das beste Gesundheitssystem der Welt hat. Sollten solche Fragen trotzdem auftauchen, dann muss man das Dokumentationswesen so umstellen, dass die Intransparenz steigt und man sich so leichter hinter der Ausrede „die Zahlen stimmen doch alle nicht“ verbergen kann. Intransparenz ist ein hervorragendes Instrument zur Herstellung und Bewahrung von Illusionen. Seitens aller Teilnehmer, vom Patienten bis zur Gesundheitsministerin, ist es unerwünscht, das am Mythos „wir haben das weltbeste Gesundheitssystem, und das sogar gratis“ gerüttelt wird. Dabei täte es dem österreichischen Gesundheitssystem gut, ein bisschen wissenschaftlich fundierte Selbstkritik zu üben. Würde eine solche Kritik möglich sein, könnte es nicht nur einen Quantensprung in der Qualität und Patientensicherheit bedeuten, sondern paradoxerweise sogar günstiger werden. Und nur dann und auch nur vielleicht besteht die Möglichkeit das beste Gesundheitssystem zu werden. Sein tut es das bestimmt nicht, und gratis ist es ebenso wenig!