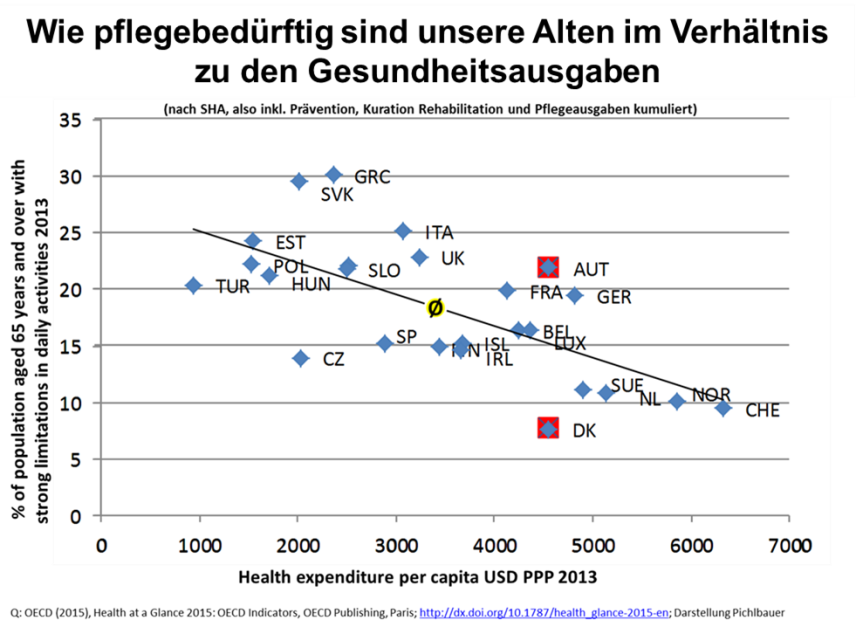Warum wir eine Gesundheitsreform brauchen, die sich am Patientenwohl und nicht an Machtstrukturen orientiert.
Weiterlesen: Das Narrativ einer echten Gesundheitsreform
Frau M. (78) lebt alleine. Die häufigen Besuche ihrer Tochter reichen aus, dass sie mit dem täglichen Leben keine Schwierigkeiten hat. Zudem kommen oft ihre Enkel samt Ur-Enkel vorbei. Das freut sie, und für diese hält sie sich auch fit. Eines Tages bekommt sie Fieber. Der Hausarzt diagnostiziert eine Lungenentzündung und schickt sie ins Spital. Dort wird sie auf Pneumokokken-Pneumonie sieben Tage lang behandelt. Im Krankenhaus lässt ihre intellektuelle Kraft Tag für Tag nach. Als sie wieder nach Hause kommt, ist sie verwirrt. Die Familie ist überfordert. Statt auf professionelle (und kostspielige) Hilfe zu setzen, versucht sie mit häufigeren Besuchen und der Übernahme von Tätigkeiten, die Frau M. früher selbst erledigt hat, zu helfen. Aber alles hilft nicht, Frau M. dämmert immer mehr ein. Sechs Monate später muss sie ins Heim, wo sie, schwer dement, nach drei Jahren stirbt.
Was ist passiert? Der Spitalsaufenthalt hat Frau M. aus der Bahn geworfen. Er stellte ein Life-Event dar, das, weil nicht richtig behandelt (reaktivierende Pflege), zur „Dekompensation“ führte – die durch eigenen Willen und Training hintan gehaltene (kompensierte) Demenz tritt plötzlich auf.
Der initiale Spitalsaufenthalt hat etwa 4000 Euro gekostet. Das Pflegeheim, das sich die Familie nicht leisten konnte, wurde von der Sozialabteilung bezahlt und kostete bis zum Tod von Frau M. 40.000 Euro. War das nötig? Nein. Beginnen wir damit, dass der Hausarzt die Pneumonie zu Hause behandeln und den Spitalsaufenthalt, der ja Auslöser war, vermeiden hätte können. Kosten, vielleicht 1500 Euro, die aktuell nur unzureichend vom Kassensystem getragen werden. Das System verdrängt gerade ältere Patienten ins Spital.
Dann das Heim. Auch das wäre nicht nötig gewesen. Würde bedarfsorientierte Pflege genauso als Sachleistung zur Verfügung stehen wie das Spital, hätte Frau M. für ein paar Wochen täglich eine reaktivierende Pflege und allenfalls eine Haushaltshilfe erhalten, die zusammen vielleicht 3000 Euro gekostet und den Verlauf hätten mildern oder gar verhindern können. Macht in Summe 4500 Euro, ein Zehntel der Summe, die aufgebracht wurde – und das bei einem deutlich besseren Ergebnis.
Natürlich ist das simpel gedacht. Die Welt wäre leicht zu retten, wenn alles so einfach wäre, aber vieles deutet darauf hin, dass es, bei sinkenden Kosten, gerade bei alten Menschen viel bringt, Spitalsaufenthalte zu vermeiden. Und selbst wenn wir annehmen, dass die Kosten nicht gesenkt werden können, eines hätten wir jedenfalls erreicht: eine höhere Lebensqualität, nicht nur für die Patientin, sondern auch für die Familie.
Um das zu erreichen, müssten die Ressourcen (das ist mehr als Geld), die wir ins Gesundheits- und Pflegesystem stecken, in eine patientenorientierte Versorgung investiert werden. Doch genau das ist nicht möglich. Denn wir verteilen nur Gelder nach (Macht)Silos – ins Kassensystem, ins Spitalsystem, ins Pflegesystem. Und dann kümmert sich jedes System mit vollem, verfassungsmäßig fixiertem Recht um sich selbst. Nur eine Verfassungsänderung könnte diese Machtblöcke daran erinnern, wofür sie da sind.
„Wiener Zeitung“ Nr. 209 vom 27.10.2017